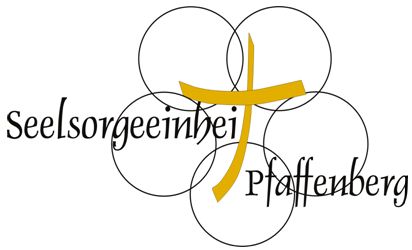Unsere Kirchen:

Unsere Wiesenkirche St. Stephanus
Die 1191 erstmals erwähnte katholische Pfarrkirche St. Stephanus, etwas außerhalb des Dorfes im Wiesental liegend in Richtung Reusten, ist ein architektonisch und ausstattungsmäßig bemerkenswertes Bauwerk der Barockzeit mit spätgotischem, barockisiertem Chor.
Chor und Turm der sogenannten "Schlosskirche" sind spätgotisch (15. Jh.), Langhaus und Zwiebelturm stammen aus der Barockzeit (1750 bis 1762). Mit dem Neubau des Kirchenschiffs wurde damals auch die Außengestalt und die Innenausstattung dem Geschmack des Barock angepasst: ein großer, durchbrochen gearbeiteter Hochaltar, zwei Seitenaltäre, die Kanzel, das spätgotische, reich verzierte Sakramentshäuschen und ein Wandkreuz von 1500 sind im Innenraum zu finden. Eine Besonderheit im Außenbereich ist die steinerne Totenleuchte aus dem 14. Jahrhundert.
Kennen Sie schon unsere Kirche St. Stephanus Poltringen:
Inneres
Das Langhaus und der eingezogene Chor bilden ein einheitlich, barock wirkendes Ganzes, in dem die spärlichen Reste des gotischen Bauwerkes kaum in Erscheinung treten. Der gesamte Innenraum wird beherrscht vom Hochaltar, der die gesamte Breite des Chores ausfüllt. Der Hochaltar wurde zu Ehren des des Kirchenpatrons St. Stephan 1762 geweiht. Rechts neben dem Hochaltar findet sich der Altar mit dem Bild des hl. Fidelis von Sigmaringen, links der Seitenaltar des Herzen Jesu.
Ihre Lage, ihr Äußeres aber auch ihr Innenraum und die Ausstattung machen sie zu einem bemerkenswerten barocken Kunstdenkmal, zu einer Fundgrube heimischen Kunsthandwerks. Im ländlichen Umland kann ihr nur wenig Vergleichbares an die Seite gestellt werden.
Die Kirchenglocken von St. Stephanus Poltringen:
Das Geläut der St. Stephanuskirche umfasst drei Glocken.
Glocke I wurde im Jahr 1409 gegossen. Der Gießer ist unbezeichnet. Sie wiegt 1099 kg und hat einen Durchmesser von 1205 mm. Es erklingt fis‘-2.
Die Glocke trägt die Inschrift:
✠lucas♦marcvs♦mathevs♦sanctvs♦iohannes♦orex♦criste♦glorie♦veni♦cvm♦pace♦anno♦dn~i♦millm~o♦cccc°♦nono♦
Lukas, Markus, Matthäus, heiliger Johannes, o Christus, König der Herrlichkeit, komm mit (deinem) Frieden, im Jahre des Herrn 1409.
Glocke II wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gegossen. Der Gießer ist unbezeichnet. Sie wiegt 612 kg und hat einen Durchmesser von 1010 mm. Es erklingt gis‘+2.
Die Glocke trägt die Inschrift:
ave❁maria❁gratia❁plena❁o❁rex❁glorie❁ criste❁veni❁cvm❁pace❁amen❁
Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, o Christus, König der Herrlichkeit, komm mit (deinem) Frieden, Amen.
Glocke III wurde im Jahr 1501 gegossen. Der Gießer ist unbezeichnet. Sie wiegt 471 kg und hat einen Durchmesser von 895 mm. Es erklingt h‘-7.
Die Glocke trägt die Inschrift:
✠ me resonante pia (maria) popvlo memento ano xvc ain iar his
Wenn ich erklinge, gedenke deines Volkes, fromme (Maria). Im Jahre 1500 (und) eins, Jesus.
Quelle: Mit freundlicher Erlaubnis entnommen aus dem Buch "Die Glocken des Landkreis Tübingen", Autor: Christoph Schapka
 Unsere Dorfkirche St. Klemens
Unsere Dorfkirche St. Klemens
Die Klemenskirche liegt auf einer kleinen Anhöhe rechts der Ammer, mitten in Dorfkern von Poltringen. Sie besteht im Kern aus einem romanischen Bau, an den im 15. Jahrhundert ein spätgotischer Chor angefügt wurde.
Seit dem Mittelalter war sie eine "Nebenkirche" von St. Stephanus und diente hauptsächlich als Werktagskirche. Eine völlig neue Rolle wuchs ihr in der Reformationszeit zu, in der sie ab 1618 einen evangelischen Pfarrer beherbergte. Erst 1818 fand wieder ein katholischer Gottesdienst in St. Klemens statt.
Der Turm der Klemenskirche erhebt sich als Chorflankenturm an der Nordseite des Chores. Der gotische Chorraum entstand im 15. Jahrhundert. Er beinhaltet einen Hochaltar, der ursprünglich in der alten katholischen Kirche in Tübingen stand. In diesem Hochaltar stehen jetzt die zwei Assistenzfiguren Maria und Johannes, die ursprünglich zu beiden Seiten eines spätgotischen Kreuzes am Triumphbogen der Klemenskirche standen.
Bei ihnen und einigen Figuren des Langhauses muss man davon ausgehen, dass sie zeitlich und stilistisch nahe stehen zu Figuren im Rottenburger Spital und der Stifts- und Pfarrkirche St. Moriz in Rottenburg am Neckar, alle geschaffen in einer Rottenburger Werkstätte im 15. Jahrhundert.
1400 (ca.): Die Kirche erhält einen Taufstein.
1410/1420: Die Assistenzfiguren des Hochaltars, Maria und Johannes, entstehen.
1436: Die Kirche erhält ihre erste und bis ins späte 19. Jh. einzige Glocke.
1520/25: Die hl. Anna Selbtritt und die hl. Elisabeth von Thürinngen mit vor ihr kniendem Bettler entstehen als Flankierfiguen für das Tabernakel. Sie veranschaulichen den Übergang von der Spätgotik in die Renaissance.
Zum Wandtabernakel lässt sich nur sagen, dass er gotisch ist – genauso wie die Eingangstür zum Turm mit Eselsückenleibung.
17. – 18. Jh.: Das ursprünglich gotische Netzgewölbe des Chors wird entfernt.
19. Jh.: Das historistisch-neugotische Hochaltarkreuz kommt hinzu.
1880 – 1890: Die Gipsdecke im Chor erhält ihre Kirchenmalereien durch Carl Dehner.
Bis 1816 war die Kirche keine rein-katholische Kirche, sondern gehörte der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde.
1920: Die Ravensburger-Figur mit vor ihr kniendem Soldat aus dem 1. Weltkrieg kommt hinzu, links davon eine Figur des hl. Papstes
1939/40: Die Kreuzwegstationen von dem Künstler Wohlfart kommen hinzu.
Die Kirchenglocken von St. Klemens Poltringen:
Das Geläut der Pfarrkirche St. Klemens umfasste seit jeher vermutlich zwei Glocken.
Glocke I wurde im Jahr 1436 gegossen. Der Gießer ist nicht bezeichnet. Sie wiegt 814 kg und hat einen Durchmesser von 1071mm. Es erklingt ein a‘.
Die Glocke trägt die Inschrift:
✠ lvcas ✠ marcvs ✠ mathevs ✠ johannes ✠ anno ✠ dni ✠ m ✠ cccc ✠ xxxvi
Lukas, Markus, Matthäus, Johannes im Jahre des Herrn 1436
Glocke II wird als Antoniusglocke bezeichnet und wurde am 29.04.1955 von KurztH’ch gegossen. Sie wiegt 381 kg und hat einen Durchmesser von 833 mm. Es erklingt c‘‘-4.
Auf der Flanke ist ein Brustbild des Heiligen Antonius mit Jesuskind auf dem Arm abgebildet.
Die Glocke trägt die Inschrift: CHRISTUM VOCO,/ DIABOLUM IMPELLO,/PACEM PETO.
auf deutsch Christus rufe ich, den Teufel vertreibe ich, den Frieden erflehe ich.